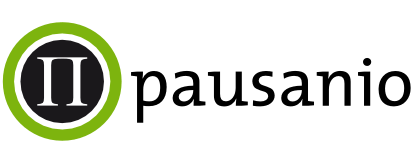Die digitale Transformation ist ein historischer Wandel. In der letzten Kolumne habe ich zwei Tools vorgestellt, die uns helfen, WIE wir den Wandel meistern können. Von solchen Tools und Haltungen gibt es immer mehr, und ich werde in der Pausanio Kolumne immer wieder solche vorstellen. Was uns aber fehlt, ist ein Verständnis für das WARUM? Warum findet dieser Wandel statt? Und warum ist er gar historisch zu nennen? Hier helfen uns Theorien, die uns Begriffe an die Hand geben, mit denen wir einen solchen Wandel in seiner gesellschaftlichen Breite und Verflechtung beschreiben und verstehen können. Ich möchte daher eine medien- und systemtheoretische Perspektive vorstellen. Wir werden dafür einen Berg erklimmen müssen, um von oben auf die Gesellschaft zu schauen. Und ich verspreche eine Aussicht, die neue Erkenntnisse bringen wird.
Eine Kolumne ist kein Ort für wissenschaftliche Diskurse. Ich kann in diesem Format nicht jedes Argument im Detail ausführen, mit Zitaten nachweisen und begründen. Ich bin aber sehr überzeugt, dass hinter jeder noch so komplexen Theorie Denkfiguren stecken, die trotz Reduktion nichts an ihrer Komplexität und Tiefe verlieren. Eine Lektüre der einschlägigen Literatur sei unabhängig davon besonders empfohlen. Folgender Gedankengang war Teil einer Keynote (online bei Youtube), die ich Anfang des Jahres auf der Tagung “Das Kunstmuseum im digitalen Zeitalter” im Belvedere in Wien vortragen durfte.
Ich will in zwei Schritten vorgehen. In dieser Kolumne geht es um ein theoretische Verständnis von dem gesellschaftlichen Wandel, in dem wir uns gerade befinden. Und in der nächsten Kolumne will ich davon sprechen, welche Bedeutung und Aufgabe dabei Kunst und Kultur zukommen. Meine These ist, dass Kunst und Kultur eine zentrale Aufgabe haben, weil sie ein wichtiges Feld bieten, um solche Veränderungen bewältigen zu können. Dies ist für mich eine besondere Motivation in meiner Arbeit.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Wandel in der Geschichte zu beschreiben. Es kommt auf den Standpunkt des Beobachters an. Vielfach beschreiben wir den Wandel aufgrund der ökonomischen Veränderungen. Dabei zeichnen wir einen Wandel nach von der Agrarkultur zum Industriezeitalter, dem wir wiederum vier industrielle Revolutionen zuschreiben können, von der Mechanisierung der Arbeit durch die Dampfkraft (Industrie 1.0), über die Massenproduktion durch Elektrizität (Industrie 2.0) und der Automatisierung durch Computersteuerung (Industrie 3.0) bis hin zum Internet der Dinge und KI-Netzerke in der heutigen Zeit. Die Industrie 4.0. Wir können den Wandel aber auch anhand der Veränderungen der politischen Gesellschaft (Aristrokratie versus bürgerliche Gesellschaft) oder der persönlichen Lebensformen (Repression versus Individualisierung) analysieren. Die Stärke und Evidenz solcher Analysen liegt darin, dass sie den Wandel anhand von historischen Quellen und Phänomenen beschreiben. Nicht selten gehen sie aber einher mit einer Ideologie, die diese Entwicklung normativ bewertet und z.B. als Ergebnis des Kapitalismus verbrämt oder feiert, oder sie bietet eine Folie für restaurative oder visionäre Meinungen. Diese Beschreibungen sind damit nicht falsch und die Bewertungen ein Teil des gesellschaftlichen Diskurses, aber sie sind wenig hilfreich für ein tiefergehendes Verstehen vom Wandel. Wir brauchen also einen Meta-Standpunkt, von dem aus wir fragen: Was leistet sich Gesellschaft, wenn sie sich eine Industrie 4.0 leistet? Welches Problem löst der Computer in der Gesellschaft? Warum funktioniert Gesellschaft wie?
Schreiten wir also den Berg nun noch einen Schritt höher und nehmen einen Metastandpunkt ein. Hier brauchen wir eine Theorie der Gesellschaft, wie sie uns die Soziologie bieten kann. Die vermutlich differenzierteste Theorie der Gesellschaft bieten uns die Arbeiten zur Systemtheorie von Niklas Luhmann. Ich glaube man kann sicher behaupten, dass sie die Gesellschaftstheorie ist mit der größten Ausstrahlung für Theoriebildung in andere Funktionsbereiche der Gesellschaft wie z.B. Politik, Wirtschaft, Bildung oder Psychologie. Wie würde Luhmann von diesem Standpunkt aus den gesellschaftlichen Wandel beschreiben?
Wir müssen dafür vorweg wenige Begriffe der Systemtheorie klären. Luhmann beschreibt Gesellschaft nicht durch Einheiten z.B. anhand von menschlichen Individuen, sondern er beschreibt sie als ein soziales System, das sich von seiner Umwelt unterscheidet z. B. von der Natur, also als eine Differenz von System und Umwelt, welches wiederum Teilsysteme ausbilden kann wie z. B. Wissenschaft, Wirtschaft, Politik etc. Und wie geschieht dies? Durch Operationen. Diese Operationen folgen zwei Bedingungen, sie sind immer auf das System selbst bezogen (selbstreferenziell) und die Operationen werden von dem System stets selber hergestellt (autopoetisch). Ein System besteht also aus Operationen, die immer wieder Anschlussoperationen erzeugen müssen, ansonsten würde das System nicht mehr existieren. Doch was sind diese Operationen in sozialen Systemen? Handlungen können es nach Luhmann nicht sein, weil Handlungen nicht immer Anschlussoperationen zur Folge haben. Für Luhmann bestehen soziale Systemen ausschließlich aus Operationen der Kommunikation. Sein ironisches und stark angegriffenes Zitat, dass Gesellschaft nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen bestehe, wird nun verständlich. Und da man nach Paul Watzlawik “nicht nicht kommunizieren” kann, sind auch Anschlussoperationen durch Kommunikation stets gesichert. An dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass Luhmann innerhalb seiner Theorie geschlossener Systeme einen sehr differenzierten Kommunikationsbegriff entwickelt, der sich von den klassischen Sender-Empfänger-Modellen unterscheidet, und Kommunikation als eine dreifache Selektion, als eine Einheit von Information, Mitteilung und Verstehen beschreibt. Ohne darauf weiter einzugehen folgt aus dieser dreifachen Selektion die ungeheure Kontingenz von Gesellschaft. Und darin gründet die von Systemtheoretikern so häufig gestellte Frage: Warum ist Gesellschaft wie möglich? Denn eigentlich ist sie unmöglich und es braucht einen ungeheuren Aufwand an Strukturbildung, dass sie möglich ist und sich selbst erhält. Und dies kann man beobachten und beschreiben.
Diese Begriffe sollten vorerst reichen, damit wir Luhmann weiter begleiten können, wie er von diesem hohen Ausblick auf dem Berg nun den Wandel der Gesellschaft beobachtet. Denn wenn Kommunikationen die zentralen Operationen sind, dann – so seine These – müsste das Auftauchen von neuen Kommunikationsmedien wie z.B. der Sprache oder der Schrift zu massiven neuen Möglichkeiten und gar zur “Katastrophe” für das System führen. Denn neue Möglichkeiten in der Kommunikation führen zu Sinnüberschüssen, auf die das System mit struktureller Anpassung reagieren muss. Den Wandel der Gesellschaft können wir dann also beschreiben anhand eines Wandels der zentralen Kommunikationsmedien. Hier profitiert Luhmann von den Forschungen der Medienwissenschaften und speziell von Marshal McLuhan, der mit seiner These “The Medium is the Massage” die Perspektive von dem Inhalt auf das Medium der Kommunikation lenkt.
Den gesellschaftlichen Wandel können wir also anhand des Wandel der Kommunikationsmedien beschreiben. Auch hier sei wieder die einschlägige Literatur, vor allem von Dirk Baecker, einem Schüler von Niklas Luhmann, empfohlen, da wir im Folgenden nur die Konturen nachzeichnen können. Im Fokus unserer Beobachtung des Wandels stehen hier vor allem vier Kommunikationsmedien, die wir daraufhin prüfen, welchen Sinnüberschuss sie produzieren und mit welchen Veränderungen die Gesellschaft reagiert. Ich folge hier sehr eng einer medienarchäologischen Untersuchung, wie sie Dirk Baecker in seinen Forschungen unternimmt.
Das erste und ursprünglichste Kommunikationsmedium ist die Sprache. Mit der Entwicklung der Sprache entsteht ein Sinnüberschuss durch die Trennung von Erleben und Sagen. Mit Worten kann nun alles gesagt werden. Auch Lüge ist nun möglich. Die Gesellschaft bildet in diesen Zeiten den Mythos als stabilisierenden Faktor heraus. Der Mythos selektiert im Geheimnis aus dem Möglichkeitshorizont der Sprache das “Richtige” und “Wahre” heraus. Zur Gesellschaft gehört man durch Geburt und Verwandtschaft, die segmentär in Kasten, Klassen oder Schichten geteilt ist. Mit der Begrifflichkeit der Systemtheorie können wir sagen, dass die Gesellschaft mit zwei Formen auf den Einbruch eines neuen Kommunikationsmedium reagiert. Als Strukturform bildet sie die segmentäre Stammesgesellschaft heraus und als Kulturform den Mythos. Und es entstehen erste Kunstwerke (aber noch kein ausdifferenziertes Kunstsystem), um die Erfahrung des Mythos sicherzustellen.
In einem nächsten Schritt tritt das Verbreitungsmedium Schrift als Kommunikationsmedium hinzu. Während Sprache nur im Vollzug geschieht, bietet die Schrift nun die Möglichkeit, dass ein Abwesender in der Kommunikation anwesend ist. Die Erweiterung durch die Schrift ist für die bestehende Gesellschaft eine “Katastrophe”. Denn auf einmal können sich Anwesende auf Schriftzeugnisse wie Quittungen, Gesetzestexte und heilige Schriften beziehen und damit Abwesendes in die Kommunikation integrieren. Die antike Schriftgesellschaft hat diesen Sinnüberschuss bewältigt, in dem sie als Kulturform die Teleologie erfunden hat. Aristoteles ist hier der Ziehvater, der die Idee groß gemacht hat, dass man jedes nur denkbare Sinnangebot nach seinem Ziel, bzw. seinem Zweck hin prüfen kann. An die Stelle des Mythos und der Magie tritt die Sophia, die Weisheit als Ziel der menschlichen Erkenntnis. Natürlich gibt es auch das Alte, die Magie weiterhin, aber das Neue tritt vielfach an seine Stelle. Die Gleichzeitigkeit von alten und neuen Formen ist ein sehr spannendes Untersuchungsfeld, ebenso wie das Phänomen Zeit als kontrollierter Zugang auf Vergangenheit und Zukunft. Beides müssen wir aufgrund der Reduktion des Gedankenganges beiseite stellen. Als Strukturform der Gesellschaft bildet sich schließlich in der Antike die Aristokratie. Herrschaft und Rebellion gegen Herrschaft ist nun möglich, und in Athen bildet sich die Polis als Ideal eines Staates heraus, die eine gewisse Stabilität verleiht.
Der nächste historische Wandel in der Gesellschaft wird durch das neue Verbreitungsmedium des gedruckten Buches hervorgerufen. Der Buchdruck ermöglicht die massenhafte Verbreitung des geschriebenen Wortes. Es entsteht ein massiver Sinnüberschuss, weil alles Geschriebene nun vergleichbar wird. Geldscheine, Zeugnisse, Bücher, Flugblätter oder Gerichtsurteile müssen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sie können auch nebeneinander gelegt und verglichen werden. Und auch hier muss die Gesellschaft reagieren. Mit der Erfindung des gedruckten Buch bilden sich nun unterschiedliche Teilsysteme heraus, die Luhmann funktional ausdifferenzierte Systeme nennt. Sie sind deswegen funktional ausdifferenziert, weil deren Operationen Kommunikationen in spezifischen Erfolgsmedien sind. Das Wissenschaftssystem kommuniziert im Erfolgsmedium der Wahrheit und fragt nach dem, was wahr oder unwahr ist. Das Wirtschaftssystem kommuniziert im Erfolgsmedium Geld und sein Ziel ist Geld haben oder nicht haben. Das politische System kommuniziert im Medium Macht, das Religionssystem im Medium Glaube und das Rechtssystem im Medium Recht. Es bildet sich auch ein Kunstsystem heraus, das im Erfolgsmedium Schönheit, bzw. Angemessenheit operiert. Die vielfältige Landschaft der funktional ausdifferenzierten Teilsysteme einer Gesellschaft können wir heute an jeder Bibliothekssystematik ablesen. Als Strukturform der Buchgesellschaft bildet sich seit dem 15. Jahrhundert die funktional ausdifferenzierte Gesellschaft heraus und für Systemtheoretiker damit die moderne Gesellschaft, die im 19. Jahrhundert die bürgerliche Gesellschaft hervorbringt. Als Kulturform bildet sie die Kritik heraus als Rationalisierung der Systeme. Die Kritik stellt das “unruhige Gleichgewicht“, wie es Luhmann nennt, in der modernen Gesellschaft sicher und ermöglicht die Demokratie als eine der politischen Formen in der Moderne. Es bilden sich rational organisierte Organisationssysteme heraus, von der preussischen Verwaltungsbehörde über Unternehmen, Schulen und Gerichte bis zu Museen und Universitäten. Dies ist die moderne Gesellschaft, wie wir sie heute kennen.
Man merkt an dieser Stelle bereits, dass die Beschreibung eines Wandels der Gesellschaft nach Kommunikationsmedien andere “Epochengrenzen” hervorbringt als sie die Geschichtswissenschaft aufwirft. Auf den zu Lebzeiten Luhmanns häufig heftigen geführten und unnötigen Streit gehe ich hier nicht weiter ein, auch wenn er bisweilen heute noch nachwirkt. Er ist deswegen unnötig, weil in der bisherigen Darlegung klar geworden sein sollte, dass wir einen historischen Wandel unterschiedlich beschreiben können. Für einen gesellschaftlichen Wandel gibt uns die Theorie sozialer Systeme verlässliche Begriffe an die Hand, mit denen wir Veränderungen beschreiben und verstehen können.
Die moderne Gesellschaft prägt uns in seiner Strukturform der funktionalen Differenzierung der Teilsysteme und der Kulturform durch die Kritik und das “unruhige Gleichgewicht” bis heute. Sie ist in vielen Punkte eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die vieles von dem ermöglicht hat, was uns heute wichtig ist, wie z.B. die bürgerliche Freiheit, Demokratie und stabile Organisationsabläufe. Da fällt Wandel schwer, vor allem wenn das Ziel weit am Horizont im tiefen Dunst liegt. Zugleich stellen wir fest, dass ein unglaublicher Druck auf der Gesellschaft und ihre Teilsysteme liegt. Die digitale Transformation betrifft alle Lebensbereiche. Und an ganz vielen Stellen spüren wir, dass die alten Konzepte in Wirtschaft, Politik und Bildung uns nicht mehr helfen, die Probleme von heute zu lösen. Das alte System fühlt sich starr an, wenig flexibel und es ist langsam. Und die anstehenden Probleme wie z.B. die Globalisierung, Digitalisierung und das Klima erweisen sich als zu komplex.
Es gibt viele Anzeichen, dass wir uns in eine neue Gesellschaft bewegen, von der wir noch nicht wissen, wie sie sein wird. Nun stehen wir aber auf diesem Berg und haben mit den Begriffen der Theorie sozialer Systeme beschreiben können, wie Gesellschaften auf neue Kommunikationsmedien reagieren und wie sie den neuen Sinnüberschuss durch Strukturformen und Kulturformen bewältigen. Natürlich können wir damit nun nicht die Zukunft vorhersagen. Aber vielleicht können wir im Dunst des Horizontes Konturen erkennen und Aufgaben und Fragestellungen herausarbeiten, die uns im Prozess der Transformation helfen können.
Das neue Verbreitungsmedium ist der Computer. Sicher, das Binärsystem von 0 und 1 hatte bereits Gottfried Wilhelm Leibniz 1697 niedergeschrieben und Konrad Zuse 1941 mit dem Z3 den erster Computer der Welt vorgeführt, der Rechenoperationen durchführen konnte. So eine historische Perspektive. Damit haben wir aber noch kein relevantes Verbreitungsmedium. Erst in den folgenden Jahrzehnten setzt sich der Computer nach der Erfindung der Halbleitertechnik mit den Grossrechnern der 60er Jahre und den Personal Computern der 80er Jahre als Verbreitungsmedium durch. Heute hat jeder dritte Mensch auf der Erde Zugriff auf ein Smartphone und der Computer ist ein zentrales Medium unserer Kommunikation. Was zeichnet den Computer als Verbreitungsmedium aus? Der Computer hat ein Gedächtnis und kann mit seinen Programmen immer mehr und immer schneller Daten verwalten. Der Computer ist nicht nur Werkzeug, sondern durch die künstliche Intelligenz geschieht es erstmals, dass jemand Unbekanntes mit kommuniziert, der kein Bewusstsein hat. Das ist neu und erzeugt einen Sinnüberschuss auf den Gesellschaft reagieren muss.
Die Strukturform der “nächsten Gesellschaft” kennen wir nicht. Schon der Begriff “nächste Gesellschaft” ist ein Verlegenheitsbegriff von Dirk Baecker, den er einem der großen Organisationstheoretiker, Peter F. Drucker, entlehnt hat, der 2001 mit 92 Jahren eine “Next Society” prognostizierte, auf deren Sinnüberschuss die Organisationen nicht mit den alten Konzepten reagieren können. Es gibt viele gute Gründe, die nächste Gesellschaft als eine Netzwerkgesellschaft (Manuel Castel) zu beschreiben. Die Häufung von Trends in den Teilsystemen, von holokratischen Organisationsmodellen, über Grundeinkommen und New Work bis hin zu Gemeinwohl-Ökonomie und des Buen Vivir, sind alles Anzeichen dafür, dass die Suche nach neuen Formaten in den Teilsystemen angekommen ist.
Auch wenn wir die Strukturformen und Kulturformen der nächsten Gesellschaft noch nicht erkennen, so können wir aber den Sinnüberschuss analysieren, mit dem wir durch Einführung des Computers rechnen können und den Gesellschaft bewältigen muss.
Marshal McLuhan hat im Kontext der Einführung der Elektrizität bereits hervorgehoben, dass die Instantaneität, die augenblickliche Verbindung durch Lichtgeschwindigkeit, eine der größten Errungenschaften in der Mediengeschichte sei. Das Telefon und später das Radio und Fernsehen ermöglichen Übertragungen im selben Augenblick. Mit dem Computer potenziert sich diese Herausforderung dahingehend, dass er nicht nur die zeitgleiche Übertragung aller Medienformate ermöglicht, sondern auch noch Interaktionen. Mit dem Computer ist erstmalig eine instantane Kommunikation in beide Richtungen möglich. Jede noch so private Information kann für alle sofort zugänglich gemacht und jeder Stammtisch zum Kommunikationspartner einer weltumspannenden Interaktion werden. Wir nutzen diese Möglichkeiten von Skype bis Twitter für globale Kommunikationen, sie erleichtern unsere Alltag und erzeugen sogleich einen massiven Kontrollüberschuss. Im Übergang zur nächsten Gesellschaft reagieren wir mit den herkömmlichen Formaten der alten Teilsysteme Recht und Politik, die aber nicht mehr angemessene Formen zur Verfügung stellen, mit denen wir diesen Überschuss bewältigen können.
Computergenerierte Netzwerke sind Plattformen. Sie sind wie Bahnsteige, die eine Verbindung von dem einen zum anderen darstellen. In der Wirtschaft wurde diese Eigenschaft längst als Mehrwert erkannt. Amazon, Twitter, Facebook und Tinder sind nichts anderes als Plattformen, die ständig neue Verbindungen ermöglichen. Ebenso wie die Verbindungen hergestellt werden, können sie auch wieder gelöst werden. Sie erweisen sich damit als ungeheuer dynamisch und transformieren bestehende Geschäftsmodelle vom Einzelhandel über Zeitungen bis hin zu Partnerschaftsbörsen. Google generiert sich als mächtige Wissensplattform. Verstanden sich in der modernen Gesellschaft die Bibliotheken als Speicher des Wissens, so transformiert diesen Anspruch Google in die digitale Welt und erzeugt einen bisher einzigartigen Wissensgraphen. Auch die Wissenschaft hat – wenn bisher noch viel zu zaghaft – das Semantic Web und Linked open Data als Methoden entdeckt, die Erkenntnisse ihrer Forschungen in Wissensgraphen offen zugänglich zu machen. Sicherte die Bibliothek doch noch eine gewisse Exklusivität und Kontrolle, so fordern die Plattformen eine radikale Offenheit heraus. Der in den letzten 20 Jahren immer wieder aufkeimende Streit um Open Access ist ein Schauplatz der alten und neuen Welt, oder anders formuliert, es ist ein notwendiges Suchen nach neuen Struktur- und Kulturformen für die nächste Gesellschaft.
Der Computer ist in der Lage komplexe Rechenleistungen zu erbringen und mit Algorithmen der künstlichen Intelligenz auch selber zu lernen. Längst hat der Computer die Leistungen des Menschen auf der Ebene der Datenverarbeitung hinter sich gelassen. Der Computer stellt Komplexität her und ermöglicht durch seine Programmierung wiederum eine Reduktion von Komplexität. Das macht den Computer so attraktiv für den Menschen, der mit dem Computer komplexe Prozesse besser verstehen und bewältigen kann. Dies betrifft nicht nur die heute sehr präzisen Wettervorhersagen, die nur aufgrund von Berechnungen sehr komplexer Wettermodelle möglich sind. So werden Computer die Komplexität von Verkehrsströmen besser erfassen als der Mensch. Wie weit wir die Anzahl der Verkehrstoten dadurch weltweit reduzieren können, liegt nur noch daran, wie selbständig der Computer die Steuerung übernimmt. Die Bewältigung von Komplexität wird ein entscheidendes Element der nächsten Gesellschaft sein.
Der Münchner Soziologe Armin Nassehi stellt die Frage: Für welches Problem in der Gesellschaft ist die Digitalisierung die Lösung? Eine seiner zentralen These, der er ausführlich in seiner Theorie der digitalen Gesellschaft nachgeht ist: zur Reduktion und Bewältigung von Komplexität. Der Computer setzt sich nicht durch, weil bestimmte Unternehmen es wünschen, das auch, aber vor allem und zu allererst, weil die Aufgaben und Probleme der Gesellschaft immer komplexer werden und die Gesellschaft diese nur mit dem Computer bewältigen kann. Dies verweist auf ein nächstes Dilemma, welches wir lösen müssen. Wenn wir mehr Digitalisierung in der nächsten Gesellschaft brauchen, dann müssen wir die Erzeugung von Energie aus nachhaltigen Ressourcen klären. Klima und Digitalisierung sind schon heute nicht mehr getrennt zu diskutieren.
Nun stehen wir auf dem Berg und haben einen ersten Überblick über den Wandel der Gesellschaft gewonnen. Unsere medienarchäologische Beobachtungen haben gezeigt, wie neue Kommunikationsmedien Sinnüberschüsse produzieren und wie die Gesellschaft diese bisher bewältigt hat. Vermutlich sind wir etwas müde beim Abstieg und so mancher Blick zum Horizont beunruhigt. Das liegt aber in der Sache begründet. Weil die digitale Transformation ein historischer Wandel ist, der alle Teilsysteme in unserer Gesellschaft betrifft. Wir können seine Elemente nun vielleicht etwas besser beschreiben und analysieren, wir haben aber immer noch keine Strukturform und Kulturform gefunden. Dieser Prozess weckt Ängste und vielfach erleben wir heute in der politischen oder privaten Diskussion konservative oder gar restaurative Bestrebungen, die die Zeit zurück drehen wollen. Das wird nicht möglich sein. Wir müssen uns auf den Weg begeben und nach neuen Strukturformen und Kulturformen suchen. Das gilt vor allem und besonders auch für das Kunstsystem. Dazu aber mehr in der nächsten Kolumne.
weiterführende Literatur und Links
Dirk Baecker: Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt am Main 2007.
Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bd. 10. Aufl. Frankfurt am Main 1998.
Armin Nassehi: Muster: Theorie der digitalen Gesellschaft. 2. Aufl. München 2019.
Holger Simon: Vom Musentempel zum postdigitalen Museum. Ein Labor für die nächste Gesellschaft, Keynote auf Internationaler Tagung “Das Kunstmuseum im Digitalen Zeitalter”, 9.01.2020, Belvedere 21, Wien

Holger Simon